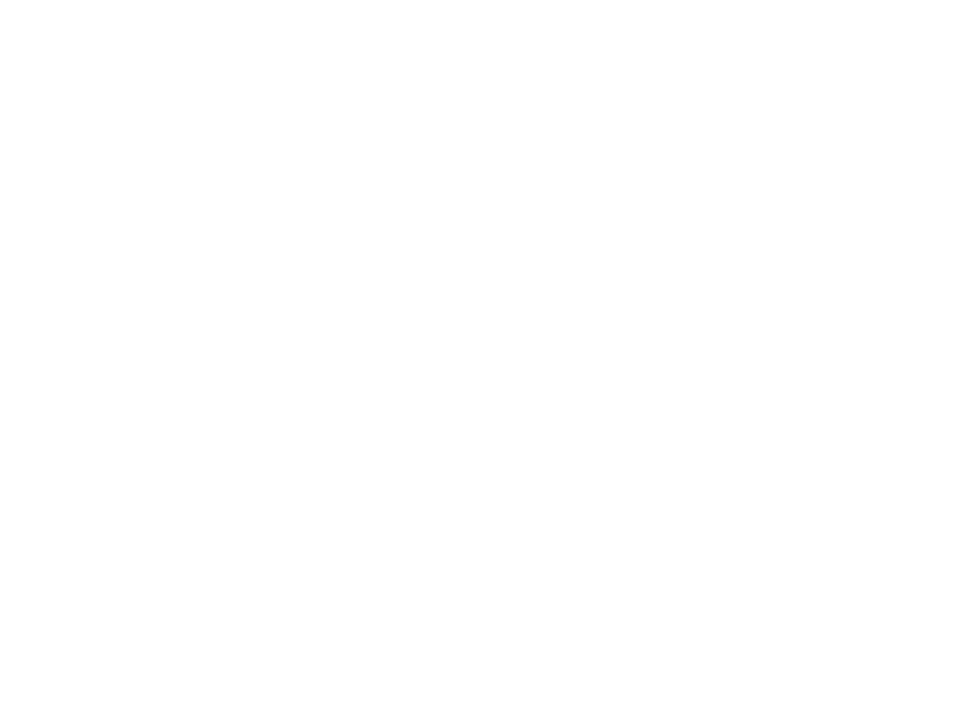Legende der Schokoladenentdeckung
Legende der Schokoladenentdeckung
Kommunikationsanalyse
Kommunikationsanalyse
In der Kommunikationstheorie übermittelt der Sender eine Botschaft an einen Empfänger. Die Botschaft der Legende kombiniert «Zufall» mit «Wochenende». Zufälle hängen allgemein mit Glück zusammen. Ist man einer Person wohlgesonnen, kann ein Zufall mit dem Glück des Tüchtigen erklärt werden. Tüchtigkeit steht jedoch eher im Widerspruch zur Freizeit, welche wiederum das Wochenende betrifft. Daraus folgt, dass die Legende den Zufall wohl eher dem Anfängerglück zuschreiben möchte. Die Spannweite zwischen einem Pionier und einem Anfänger wäre jedoch gross. Demnach wäre die Legende eine Abwertung. Der Person wäre man somit wohl eher nicht wohlgesinnt. In «Patriarchen» wird R. Lindt gleich mehrmals als «Anfänger» beschrieben. Diese Stellen lassen sich unter «Zufall» kategorisieren. Ebenso wird er mehrmals als «freizeitorientierte» Person dargestellt. Diese Beschreibungen können der Kategorie des «Wochenendes» zugeordnet werden.
In der Kommunikationstheorie übermittelt der Sender eine Botschaft an einen Empfänger. Die Botschaft der Legende kombiniert «Zufall» mit «Wochenende». Zufälle hängen allgemein mit Glück zusammen. Ist man einer Person wohlgesonnen, kann ein Zufall mit dem Glück des Tüchtigen erklärt werden. Tüchtigkeit steht jedoch eher im Widerspruch zur Freizeit, welche wiederum das Wochenende betrifft. Daraus folgt, dass die Legende den Zufall wohl eher dem Anfängerglück zuschreiben möchte. Die Spannweite zwischen einem Pionier und einem Anfänger wäre jedoch gross. Demnach wäre die Legende eine Abwertung. Der Person wäre man somit wohl eher nicht wohlgesinnt. In «Patriarchen» wird R. Lindt gleich mehrmals als «Anfänger» beschrieben. Diese Stellen lassen sich unter «Zufall» kategorisieren. Ebenso wird er mehrmals als «freizeitorientierte» Person dargestellt. Diese Beschreibungen werden der Kategorie des «Wochenendes» zugeordnet.
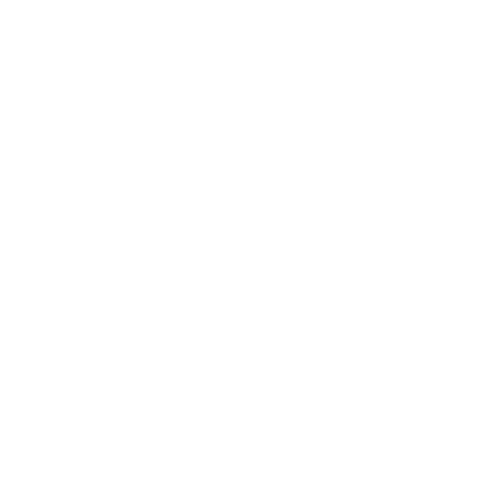
Praxistext
Praxistext
Zitat: Was dann geschah, ist von Legenden umrankt und nicht mehr zu klären. Manche behaupten, R. Lindt habe monatelang getüftelt, bis er eine Lösung fand; andere sagen, er habe an einem Freitag einfach seine vom Wasserrad betriebene Rührmaschine abzustellen vergessen, bevor er zur Jagd oder einem galanten Abenteuer aufbrach, weshalb die Schokoladenmasse drei Tage und drei Nächte lang ununterbrochen gerührt worden sei. Wie auch immer: Als Lindt am Montag in die Fabrik zurückkehrte, fand er in seinem Bottich eine glänzende Masse vor, die mit herkömmlicher Schokolade keinerlei Ähnlichkeit mehr hatte (Patriarchen, A. Capus, S. 20).
Gegendarstellung: Damit das Wasser des Kakaos verdampfen kann, wird die Masse während des Conchierens stark erhitzt. Eine Masse trocknet aus, wenn ihr Wasser entzogen wird. Ein ausgetrocknetes Kakao-Zucker-Gemisch würde zudem steinhart. Unter diesen physikalischen Bedingungen wäre die Masse ausgetrocknet, dann ausgehärtet und schliesslich verbrannt, wenn man die Conchiermaschine tatsächlich ohne Aufsicht über den Zeitraum eines Wochenendes hätte arbeiten lassen. Am Montagmorgen wäre es also alles andere als eine glänzende Schokoladenmasse gewesen. Da sich die verbrannte Masse nicht mehr aus dem Behälter hätte entfernen lassen, wäre die Folge dieser Unachtsamkeit der Totalschaden der Maschine gewesen. Wenn man bedenkt, dass es sich um einen Prototyp handelte, hätte das Entwicklungsprojekt damit höchst wahrscheinlich Schiffbruch erlitten. In Wirklichkeit war die Conche von R. Lindt noch mit sehr viel Handarbeit verbunden. Während des Betriebs musste man Resten oberhalb der Walze (Läufer) am Beckenrand herunterspachteln, um auch dort ein Aushärten zu verhindern. Darüber hinaus musste die Oberfläche der Masse stets im Auge behalten werden und sobald sie trocken wurde, war ein wichtiger Handgriff nötig. Um ein Austrocknen zu verhindern, musste immer wieder etwas Kakaobutter daruntergemischt werden. Nur so konnte genügend lange conchiert werden, bis ausreichend Wasser verdampft war. Das zusätzliche Kakaofett wirkt wie ein Schmiermittel und ist zudem ein wichtiger Grund für die Schmelzeigenschaft einer Schokolade. Durch den erhöhten Fettgehalt in der Masse musste ausserdem ein weiteres Verfahren definiert werden. Für eine einwandfreie Qualität muss die conchierte Masse nämlich auch noch temperiert werden. Die Berner Version der Formel von R. Lindt lautet demnach mindestens Conchieren und Temperieren der Masse. Folglich wurde am Flussufer der Aare ein mehrstufiges Verfahren entwickelt. Wenn überhaupt wäre durch Zufall lediglich ein Teilerfolg erzielt worden. Die verschiedenen Verfahren hinsichtlich der Schmelzeigenschaft einer Schokolade werden in dieser Gegendarstellung teilweise als Berner Verfahren bezeichnet. Die Wahl dieser Bezeichnung wird im Kapitel der Folgen am Ende des Abschnittes über die Schokoladenentwicklung begründet.
Abweichung: Der Fakten-Check fällt also negativ aus. Die Legende hat weder mit Schokolade noch mit Karamell etwas zu tun. Jetzt könnte aber die Frage aufkommen, wieso das Berner Verfahren auch nach Jahren noch nicht schweizweit entschlüsselt wurde. Dies würde ja der Legende widersprechen, weil aus reiner Nachlässigkeit resultierende Erfolge üblicherweise rasch bekannt werden.
Da sich die Urheber der Legende bestens mit der Materie auskennen, wird sie vorsichthalber immer als Alternative zu den Fakten erwähnt. Ausserdem wird sie jeweils mit einer leicht ironisch klingenden Formulierung ummantelt (dragiert). Der Empfänger der Botschaft kann sie so auch als Witz interpretieren. Beim «Zufallswochenende» bleiben die Informationen über den Streit und die Todesfälle jedoch im Dunkeln. Im nächsten Kapitel muss dieser Hintergrund deshalb auch noch beleuchtet werden. Danach können ironische Absichten hinter der Legende definitiv ausgeschlossen werden.
Die Urheber scheinen aber den Kern der Sache nicht verstanden zu haben. Der springende Punkt ist nämlich die Verschmelzung. Diese steht synonym für Vereinigung. Die Legende begünstigt hingegen eher die Trennung. Und zwar die Trennung zwischen Namen und Person. Und auch die Trennung zwischen Lebenswerk und Geburtsstadt. Mehr dazu wird im Kapitel über die Auswirkungen folgen.
Es ist aber bereits augenfällig, dass das logische Szenario einer längeren Entwicklungsphase nur in einem Satz beschrieben wird. Die unlogische Legende wird hingegen in mehreren Sätzen erklärt. Dieses Ungleichgewicht kann bereits als Beeinflussung des lesenden Publikums gewertet werden. Es hat sich aber gerade herausgestellt, dass die Legende inhaltlich falsch ist. Für die weitere Analyse muss sie nun auch noch filetiert werden. Auf diesem Weg wird zuerst die «Zufallsthematik» geprüft. Das «Wochenende» wird danach an der Reihe sein.
Zitat: Was dann geschah, ist von Legenden umrankt und nicht mehr zu klären. Manche behaupten, R. Lindt habe monatelang getüftelt, bis er eine Lösung fand; andere sagen, er habe an einem Freitag einfach seine vom Wasserrad betriebene Rührmaschine abzustellen vergessen, bevor er zur Jagd oder einem galanten Abenteuer aufbrach, weshalb die Schokoladenmasse drei Tage und drei Nächte lang ununterbrochen gerührt worden sei. Wie auch immer: Als R. Lindt am Montagmorgen in die Fabrik zurückkehrte, fand er in seinem Bottich eine glänzende Masse vor, die mit bisheriger Schokolade keinerlei Ähnlichkeit mehr hatte (Patriarchen, A. Capus, S. 20).
Gegendarstellung: Damit das Wasser des Kakaos verdampfen kann, wird die Masse während des Conchierens stark erhitzt. Eine Masse trocknet aus, wenn ihr Wasser entzogen wird. Ein ausgetrocknetes Kakao-Zucker-Gemisch würde zudem steinhart. Unter diesen physikalischen Bedingungen wäre die Masse ausgetrocknet, dann ausgehärtet und schliesslich verbrannt, wenn man die Conchiermaschine tatsächlich ohne Aufsicht über den Zeitraum eines Wochenendes hätte arbeiten lassen. Am Montagmorgen wäre es also alles andere als eine glänzende Schokoladenmasse gewesen. Da sich die verbrannte Masse nicht mehr aus dem Behälter hätte entfernen lassen, wäre die Folge dieser Unachtsamkeit der Totalschaden der Maschine gewesen. Wenn man bedenkt, dass es sich um einen Prototyp handelte, hätte das Entwicklungsprojekt damit höchst wahrscheinlich Schiffbruch erlitten. In Wirklichkeit war die Conche von R. Lindt noch mit sehr viel Handarbeit verbunden. Während des Betriebs musste man Resten oberhalb der Walze (Läufer) am Beckenrand herunterspachteln, um auch dort ein Aushärten zu verhindern. Darüber hinaus musste die Oberfläche der Masse stets im Auge behalten werden und sobald sie trocken wurde, war ein wichtiger Handgriff nötig. Um ein Austrocknen zu verhindern, musste immer wieder etwas Kakaobutter daruntergemischt werden. Nur so konnte genügend lange conchiert werden, bis ausreichend Wasser verdampft war. Das zusätzliche Kakaofett wirkt wie ein Schmiermittel und ist zudem ein wichtiger Grund für die Schmelzeigenschaft einer Schokolade. Durch den erhöhten Fettgehalt in der Masse musste ausserdem ein weiteres Verfahren definiert werden. Für eine einwandfreie Qualität muss die conchierte Masse nämlich auch noch temperiert werden. Die Berner Version der Formel von R. Lindt lautet demnach mindestens Conchieren und Temperieren der Masse. Folglich wurde am Flussufer der Aare ein mehrstufiges Verfahren entwickelt. Wenn überhaupt wäre durch Zufall lediglich ein Teilerfolg erzielt worden. Die verschiedenen Verfahren hinsichtlich der Schmelzeigenschaft einer Schokolade werden in dieser Gegendarstellung teilweise als Berner Verfahren bezeichnet. Die Begründung dieser Bezeichnung erfolgt im Kapitel der Folgen am Ende des Abschnittes über die Schokoladenentwicklung.
Abweichung: Der Fakten-Check fällt also negativ aus. Die Legende hat weder mit Schokolade noch mit Karamell etwas zu tun. Jetzt könnte aber die Frage aufkommen, wieso das Berner Verfahren auch nach Jahren noch nicht schweizweit entschlüsselt wurde. Dies würde ja der Legende widersprechen, weil aus reiner Nachlässigkeit resultierende Erfolge üblicherweise rasch bekannt werden.
Da sich die Urheber der Legende bestens mit der Materie auskennen, wird sie vorsichthalber immer als Alternative zu den Fakten erwähnt. Ausserdem wird sie jeweils mit einer leicht ironisch klingenden Formulierung ummantelt (dragiert). Der Empfänger der Botschaft kann sie so auch als Witz interpretieren. Beim «Zufallswochenende» bleiben die Informationen über den Streit und die Todesfälle jedoch im Dunkeln. Im nächsten Kapitel muss dieser Hintergrund deshalb auch noch beleuchtet werden. Danach können ironische Absichten hinter der Legende definitiv ausgeschlossen werden.
Die Urheber scheinen aber den Kern der Sache nicht verstanden zu haben. Der springende Punkt ist nämlich die Verschmelzung. Diese steht synonym für Vereinigung. Die Legende begünstigt hingegen eher die Trennung. Und zwar die Trennung zwischen Namen und Person. Und auch die Trennung zwischen Lebenswerk und Geburtsstadt. Mehr dazu wird im Kapitel über die Auswirkungen folgen.
Es ist aber bereits augenfällig, dass das logische Szenario einer längeren Entwicklungsphase nur in einem Satz beschrieben wird. Die unlogische Legende wird hingegen in mehreren Sätzen erklärt. Dieses Ungleichgewicht kann bereits als Beeinflussung des lesenden Publikums gewertet werden. Es hat sich aber gerade herausgestellt, dass die Legende inhaltlich falsch ist. Für die weitere Analyse muss sie nun auch noch filetiert werden. Auf diesem Weg wird zuerst die «Zufallsthematik» geprüft. Das «Wochenende» wird danach an der Reihe sein.
Zufall
Zufall
Bevor die Textverknüpfungen geprüft werden können, muss aber noch ein weiterer Aspekt der Zufallslegende angesprochen werden. Bei einem mehrstufigen Verfahren bedeutet ein Zufallstreffer noch nicht, dass das Gesamtproblem gelöst ist. Bei komplexen Problemen gibt es zudem Abhängigkeiten, welche nur mit Fachwissen und Erfahrung erkannt werden können. Diese Voraussetzungen beissen sich jedoch mit der Zufallslogik. Für das Narrativ eines Anfängers musste deshalb auch noch die technische Errungenschaft vereinfacht werden. Zuerst wurde das Schmelzschokoladenverfahren auf die Conchiertechnik beschränkt. Hierfür wurde unter anderem das Temperieren ausgeklammert. Anschliessend musste man die verschiedenen Arbeitsschritte des Conchierens auch noch auf «längeres Rühren» reduzieren. Mit diesem innovativ-destruktiven Kniff wurde aus einem komplexen ein einfaches Verfahren konstruiert, welches sich sogar durch einen Glückstreffer entdecken liess. Zufälligerweise entspricht «längeres» Rühren genaue der Zeitspanne eines Wochenendes – ein Schelm, wer jetzt auf zartbittere Gedanken kommt. Für pädagogische Zwecke kann eine Vereinfachung sinnvoll sein. Im konkreten Fall wird aber einzig und allein die Abwertung der Errungenschaft bezweckt, um die Zufallslogik plausibilisieren zu können. Gemäss diesem Narrativ hätte die Schmelzschokolade jeder entdeckt, der etwas länger im Topf gerührt hätte. Ein solcher Vereinfachungsversuch kommt im nachfolgenden Zitat besonders gut zum Ausdruck.
Zitat: Er taufte seine wundersame Kreation «Chocolat Fondant» -schmelzende Schokolade. Dass man die Schokolade sehr lange rühren muss – das war R. Lindts ganzes Geheimnis. Dass er das zwanzig Jahre lang vor der neugierigen Konkurrenz verheimlichen konnte, ist schon erstaunlich (Patriarchen, A. Capus, S. 20).
Gegendarstellung: Rühren ist das eine; die korrekte Temperatur, Conchierdauer und Menge an Kakaobutter sind andere Parameter, welche dem lesenden Publikum vorenthalten werden. All das stand nun auch noch in Abhängigkeit. Und zwar von der Kakaosorte. Und vom Röstgrad. Und vom gewünschten Aroma der Schokolade. Unter diesen Umständen ist es alles andere als erstaunlich, dass das Geheimnis über Jahre nicht gelüftet werden konnte. Die nicht conchierten Ur-Schokoladen der Konkurrenz hatten eine wesentlich härtere Konsistenz als die zarte Schmelzschokolade. Ergo musste man sich am Fabrikationsgeheimnis wortwörtlich die Zähne ausgebissen haben. Nach der stundenlangen Bearbeitung in der Conchiermaschine muss die Masse aber auch noch einem Temperaturintervall unterzogen werden. Damit lassen sich die Kristalle in der conchierten Masse stabilisieren. Nur so hat die ausgehärtete Schokolade genügend Stabilität, damit sie vor dem Verzehr abgebrochen werden kann. Auch für das Temperierverfahren mussten zuerst einmal die korrekten Temperaturen gefunden werden. Der Vater von R. Lindt war Apotheker. Mit seinem chemisch-technischen Wissen konnte er die Entwicklung unterstützen. Im Vergleich mit den damaligen Schokoladenfabrikanten in der Schweiz war dieses Apothekerwissen schlussendlich der spielentscheidende Faktor.
Abweichung: Mangelndes Interesse am Schokoladenhandwerk wäre eine mögliche Erklärung für diese Abweichung. Jedermann hätte aber auf die Idee kommen können, einfach etwas länger im Topf zu rühren. Eine solche Entdeckung wäre sogar mit Nichtstun über ein Wochenende möglich gewesen. Gestützt auf die Fakten ist langes Rühren aber ganz klar eine Vereinfachung und möglicherweise ein Plausibilisierungsversuch des «Zufallswochenendes». Das zum Ausdruck gebrachte Erstaunen wirkt daher eher künstlich.
Das exakt gleiche Muster wiederholte sich im Dokumentarfilm «Schweiz und die Schokolade». In einer Interviewsequenz wird auch dort zuerst die Legende als Alternative zu den Fakten erwähnt. Daraufhin fragt der Reporter erstaunt:
«Das heisst sein grosses Geheimnis bestand nur darin, die Schokoladenmasse länger zu rühren?»
Darauf antwortet der Autor:
«Das ist sein einziges Geheimnis, die Maschine viel, viel länger umrühren zu lassen. Und das grosse Wunder daran ist, dass R. Lindt – er hatte ja immerhin einige Mitarbeiter – dieses so schlichte Geheimnis, das sich in einem Satz weitergeben lässt, 20 Jahre lang gehütet hat».
Im Interview wird die Einfachheit besonders hervorgehoben. Das macht den Plausibilisierungsversuch der Legende nun offensichtlich. Damit ist die Vereinfachung beziehungsweise Abwertung der Sache vorerst abgeschlossen. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf einzelne Stellen, an denen die Person abgewertet wird und welche mit dem Zufallsteil der Legende zusammenhängen. Die Zitate können dabei chronologisch analysiert werden.
Bevor die Textverknüpfungen geprüft werden können, muss aber noch ein weiterer Aspekt der Zufallslegende angesprochen werden. Bei einem mehrstufigen Verfahren bedeutet ein Zufallstreffer noch nicht, dass das Gesamtproblem gelöst ist. Bei komplexen Problemen gibt es zudem Abhängigkeiten, welche nur mit Fachwissen und Erfahrung erkannt werden können. Diese Voraussetzungen beissen sich jedoch mit der Zufallslogik. Für das Narrativ eines Anfängers musste deshalb auch noch die technische Errungenschaft vereinfacht werden. Zuerst wurde das Schmelzschokoladenverfahren auf die Conchiertechnik beschränkt. Hierfür wurde unter anderem das Temperieren ausgeklammert. Anschliessend musste man die verschiedenen Arbeitsschritte des Conchierens auch noch auf «längeres Rühren» reduzieren. Mit diesem innovativ-destruktiven Kniff wurde aus einem komplexen ein einfaches Verfahren konstruiert, welches sich sogar durch einen Glückstreffer entdecken liess. Zufälligerweise entspricht «längeres» Rühren genaue der Zeitspanne eines Wochenendes – ein Schelm, wer jetzt auf zartbittere Gedanken kommt. Für pädagogische Zwecke kann eine Vereinfachung sinnvoll sein. Im konkreten Fall wird aber einzig und allein die Abwertung der Errungenschaft bezweckt, um die Zufallslogik plausibilisieren zu können. Gemäss diesem Narrativ hätte die Schmelzschokolade jeder entdeckt, der etwas länger im Topf gerührt hätte. Ein solcher Vereinfachungsversuch kommt im nachfolgenden Zitat besonders gut zum Ausdruck.
Zitat: Er taufte seine wundersame Kreation «Chocolat Fondant» -schmelzende Schokolade. Dass man die Schokolade sehr lange rühren muss – das war R. Lindts ganzes Geheimnis. Dass er das zwanzig Jahre lang vor der neugierigen Konkurrenz verheimlichen konnte, ist schon erstaunlich (Patriarchen, A. Capus, S. 20).
Gegendarstellung: Rühren ist das eine; die korrekte Temperatur, Conchierdauer und Menge an Kakaobutter sind andere Parameter, welche dem lesenden Publikum vorenthalten werden. All das stand nun auch noch in Abhängigkeit. Und zwar von der Kakaosorte. Und vom Röstgrad. Und vom gewünschten Aroma der Schokolade. Unter diesen Umständen ist es alles andere als erstaunlich, dass das Geheimnis über Jahre nicht gelüftet werden konnte. Die nicht conchierten Ur-Schokoladen der Konkurrenz hatten eine wesentlich härtere Konsistenz als die zarte Schmelzschokolade. Ergo musste man sich am Geheimnis wortwörtlich die Zähne ausgebissen haben. Nach der stundenlangen Bearbeitung in der Conchiermaschine muss die Masse aber auch noch einem Temperaturintervall unterzogen werden. Damit lassen sich die Kristalle in der conchierten Masse stabilisieren. Nur so hat die ausgehärtete Schokolade genügend Stabilität, damit sie vor dem Verzehr abgebrochen werden kann. Auch für das Temperierverfahren mussten zuerst einmal die korrekten Temperaturen gefunden werden. Der Vater von R. Lindt war Apotheker. Mit seinem chemisch-technischen Wissen konnte er die Entwicklung unterstützen. Im Vergleich mit den damaligen Schokoladenfabrikanten in der Schweiz war dieses Apothekerwissen schlussendlich der spielentscheidende Faktor.
Abweichung: Mangelndes Interesse am süssen Handwerk wäre eine mögliche Erklärung für diese Abweichung. Jedermann hätte aber auf die Idee kommen können, einfach etwas länger im Topf zu rühren. Eine solche Entdeckung wäre sogar mit Nichtstun über ein Wochenende möglich gewesen. Gestützt auf die Fakten ist langes Rühren aber ganz klar eine Vereinfachung und möglicherweise ein Plausibilisierungsversuch des «Zufallswochenendes». Das zum Ausdruck gebrachte Erstaunen wirkt daher eher künstlich.
Das gleiche Muster wiederholte sich im Dokumentarfilm «Schweiz und die Schokolade». In einer Interviewsequenz wird auch dort zuerst die Legende als Alternative zu den Fakten erwähnt. Daraufhin fragt der Reporter erstaunt:
«Das heisst sein grosses Geheimnis bestand nur darin, die Schokoladenmasse länger zu rühren?»
Darauf antwortet der Autor:
«Das ist sein einziges Geheimnis, die Maschine viel, viel länger umrühren zu lassen. Und das grosse Wunder daran ist, dass R. Lindt – er hatte ja immerhin einige Mitarbeiter – dieses so schlichte Geheimnis, das sich in einem Satz weitergeben lässt, 20 Jahre lang gehütet hat».
Im Interview wird die Einfachheit besonders hervorgehoben. Das macht den Plausibilisierungsversuch der Legende nun offensichtlich. Damit ist die Vereinfachung beziehungsweise Abwertung der Sache vorerst abgeschlossen. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf einzelne Stellen, an denen die Person abgewertet wird und welche mit dem Zufallsteil der Legende zusammenhängen. Die Zitate können dabei chronologisch analysiert werden.
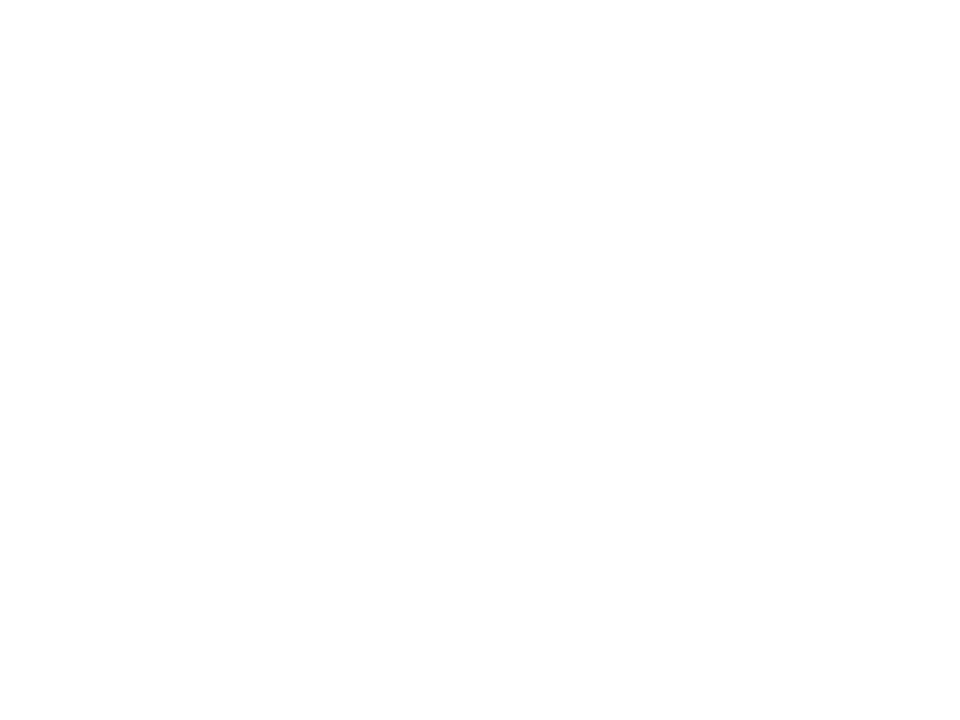
Gegendarstellung: Dieser Ausschnitt ist am Anfang der Geschichte einzuordnen. Dabei geht es um die Lehrzeit von 1873 bis 1875. Bei der Bonifikation von 300.- handelt es sich mindestens um einen damaligen Jahreslohn eines regulären Fabrikmitarbeiters. 1879 lautete der Adressbucheintrag im Mattequartier auf Lindt & Kohler. Die Zusammenarbeit zwischen dem Lehrling und seinem Meister dauerte folglich über die Ausbildungsjahre hinaus. Nebst dem Vater machte also auch noch ein langjähriger Schokoladenfabrikant bei der Entwicklung mit. Auf diese Weise kam es zur Verschmelzung zwischen Schokoladenhandwerk und Apothekerwissen. Aus diesem Wissensbecken mussten jedoch die richtigen Schlüsse gezogen werden, um die Zauberschokolade vollenden zu können. Ein weiterer Hinweis zur engen Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Lehrmeister lässt sich in den juristischen Akten finden. Ab 1880 soll ein enger Wissenstransfer zwischen R. Lindt und der Schokoladenfabrik seines Onkels in Lausanne bestanden haben (Berufung 1927, Beklagte, S. 15).
Abweichung: Für die Zufallslogik war das Westschweizer Schokoladenwissen von C. Kohler äusserst unpassend. Ohne die mehrjährige Berufserfahrung des Onkels wäre die Entwicklungsphase möglicherweise amateurhaft gewesen. Deshalb könnte diese wichtige Information entfallen sein. Im Kontext der engen Partnerschaft zwischen Lausanne und Bern ergibt es aber keinen Sinn, dass der Lehrmeister über den Abgang seines Zauberlehrlings froh gewesen sein soll. Die abwertende Bemerkung ist somit völlig unnötig. Dadurch wird sogar fälschlicherweise die Beendigung der Zusammenarbeit suggeriert. Falls damit bewusst von der professionellen Entwicklung hätte abgelenkt werden sollen, wäre die Formulierung gar irreführend.
Gegendarstellung: Dieser Ausschnitt ist am Anfang der Geschichte einzuordnen. Dabei geht es um die Lehrzeit von 1873 bis 1875. Bei der Bonifikation von 300.- handelt es sich mindestens um einen damaligen Jahreslohn eines regulären Fabrikmitarbeiters. 1879 lautete der Adressbucheintrag im Mattequartier auf Lindt & Kohler. Die Zusammenarbeit zwischen dem Lehrling und seinem Meister dauerte folglich über die Ausbildungsjahre hinaus. Nebst dem Vater machte also auch noch ein langjähriger Schokoladenfabrikant bei der Entwicklung mit. Auf diese Weise kam es zur Verschmelzung zwischen Schokoladenhandwerk und Apothekerwissen. Aus diesem Wissensbecken mussten jedoch die richtigen Schlüsse gezogen werden, um die Zauberschokolade vollenden zu können. Ein weiterer Hinweis zur engen Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Lehrmeister lässt sich in den juristischen Akten finden. Ab 1880 soll ein enger Wissenstransfer zwischen R. Lindt und der Schokoladenfabrik seines Onkels in Lausanne bestanden haben (Berufung 1927, Beklagte, S. 15).
Abweichung: Für die Zufallslogik war das Westschweizer Schokoladenwissen von C. Kohler äusserst unpassend. Ohne die mehrjährige Berufserfahrung des Onkels wäre die Entwicklungsphase möglicherweise amateurhaft gewesen. Deshalb könnte diese wichtige Information entfallen sein. Im Kontext der engen Partnerschaft zwischen Lausanne und Bern ergibt es aber keinen Sinn, dass der Lehrmeister über den Abgang seines Zauberlehrlings froh gewesen sein soll. Die abwertende Bemerkung ist somit völlig unnötig. Dadurch wird sogar fälschlicherweise die Beendigung der Zusammenarbeit suggeriert. Falls damit bewusst von der professionellen Entwicklung hätte abgelenkt werden sollen, wäre die Formulierung gar irreführend.
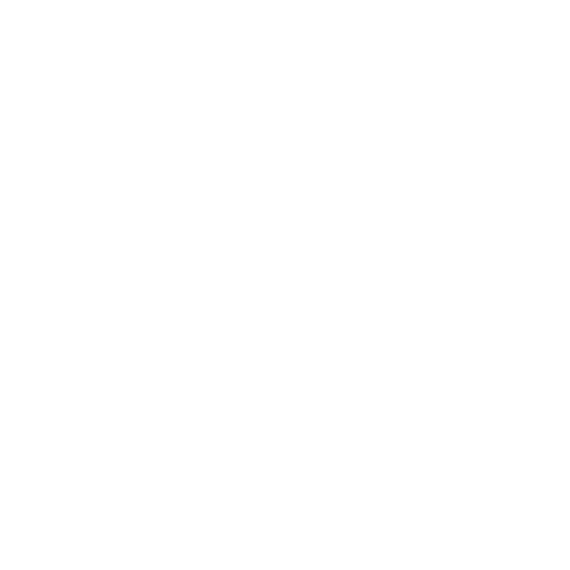
Gegendarstellung: Dieser Text folgt auf die Ausbildungsjahre in Lausanne und beschreibt den Beginn der Entwicklungsarbeiten. Tatsächlich hiess der Vater auch Rudolf. Unter Rudolf Lindt wäre man im Adressbuch der Stadt Bern somit auf zwei Einträge gestossen. Schokolade ist ein Luxusprodukt. Seine Zielgruppe parlierte zudem bevorzugt auf Französisch. Aus diesem Grund kann die französische Namenswahl bereits als Positionierung im Premiumbereich angesehen werden. Eine kaufmännische Professionalität lässt sich also durchaus erkennen. Wohlgemerkt: Die Rede ist von der Geburtsstätte der heutigen Schokolade. In der Mühle an der Aare entstand immerhin die damals beste Schweizer Schokolade. Damit war der Grundstein für die Schweiz als Schokoladenland gelegt. Unter ihrem Dach wurde also nicht weniger als Weltgeschichte geschrieben.
Abweichung: Für den Namenswechsel hätte also ein sehr pragmatischer Grund vorgelegen. Trotzdem wird die Namensänderung mit einer gewissen «Eitelkeit» begründet. Auch diese Begründung ist ganz im Sinne der Legendenlogik, wie die Analyse des «Wochenendteils» zeigen wird. Im Vergleich zu heute kann eine damalige Fabrik als schäbig bezeichnet werden. Sogleich stellt sich aber die Frage, ob das andere nicht auch waren. Diese Information ist somit überflüssig. Im Vordergrund steht aber wohl die Abwertung der Mühle. Damit würde die Beschreibung zumindest zum Narrativ eines Amateurbetriebes passen.
Gegendarstellung: Dieser Text folgt auf die Ausbildungsjahre in Lausanne und beschreibt den Beginn der Entwicklungsarbeiten. Tatsächlich hiess der Vater auch Rudolf. Unter Rudolf Lindt wäre man im Adressbuch der Stadt Bern somit auf zwei Einträge gestossen. Schokolade ist ein Luxusprodukt. Seine Zielgruppe parlierte zudem bevorzugt auf Französisch. Aus diesem Grund kann die französische Namenswahl bereits als Positionierung im Premiumbereich angesehen werden. Eine kaufmännische Professionalität lässt sich also durchaus erkennen. Wohlgemerkt: Die Rede ist von der Geburtsstätte der heutigen Schokolade. In der Mühle an der Aare entstand immerhin die damals beste Schweizer Schokolade. Damit war der Grundstein für die Schweiz als Schokoladenland gelegt. Nicht weniger als Weltgeschichte wurde unter ihrem Dach geschrieben.
Abweichung: Für den Namenswechsel hätte also ein sehr pragmatischer Grund vorgelegen. Trotzdem wird die Namensänderung mit einer gewissen «Eitelkeit» begründet. Auch diese Begründung ist ganz im Sinne der Legendenlogik, wie die Analyse des «Wochenendteils» zeigen wird. Im Vergleich zu heute kann eine damalige Fabrik als schäbig bezeichnet werden. Sogleich stellt sich aber die Frage, ob das andere nicht auch waren. Diese Information ist somit überflüssig. Im Vordergrund steht aber wohl die Abwertung der Mühle. Damit würde die Beschreibung zumindest zum Narrativ eines Amateurbetriebes passen.
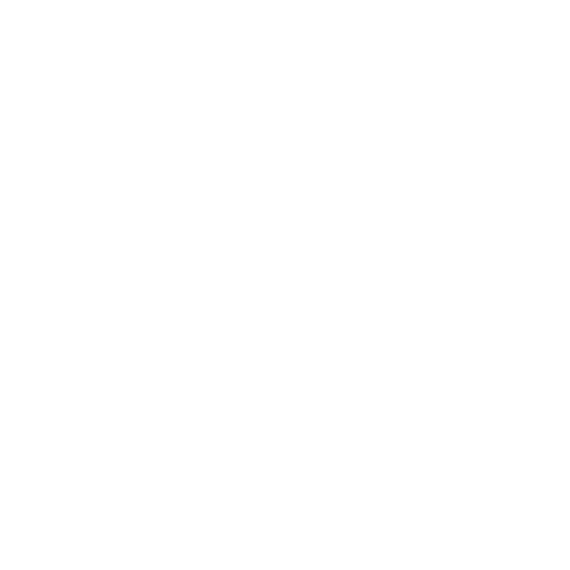
Gegendarstellung: An dieser Stelle wird die Entwicklungsphase beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt kannte man aber noch keine Lösung für das Fettreifproblem. Diese Thematik steht im Zusammenhang mit der unkontrollierten Kristallisation des Kakaofetts. Um auf die Fettkristalle einwirken zu können, musste die Masse zunächst in einen zähflüssigen Zustand gebracht werden. Dies gelang erst durch die Verfeinerung und Erhöhung des Fettgehalts während des Conchierens. Indem die Temperatur der zähflüssigen Masse anschliessend reduziert und wieder erhöht wurde, liessen sich die Kristalle stabilisieren. Die ausgehärtete Schokolade war dadurch stabil genug, um sie brechen zu können. Ausserdem erhielt sie auf diese Weise eine glänzende Oberfläche. Das Verfahren wird Temperieren genannt. Dieses Temperaturintervall führte schliesslich zur Lösung des Fettreifproblems.
Abweichung: Der Vergleich zwischen einem Lehrling und einem Profi ist das Paradebeispiel aus der «Zufallskategorie». Demnach soll das Fachwissen eines Anfängers besser gewesen sein als das von R. Lindt. Damit wird die Lehrzeit in Lausanne qualitativ infrage gestellt. Im Kontext der Schokoladenentwicklung werden jedoch Äpfel mit Birnen verglichen. Die Kenntnisse des Fettreifes waren nämlich völlig irrelevant. Im Zentrum stand vielmehr die Lösung des Fettreifproblems. Ein Konditorlehrling von anno dazumal konnte diese Kenntnis noch gar nicht haben. Der Vergleich ist somit unlogisch und führt zu einer falschen Einschätzung der Situation. So geht nämlich vergessen, dass auch noch die richtigen Temperaturintervalle für die Berner Schmelzschokolade definiert werden mussten. An dieser Stelle im Buch hätte das Temperierhandwerk unbedingt zu Wort kommen müssen. Möglicherweise wurde dieser wichtige Verfahrensschritt einfach so vergessen. Conchieren und Temperieren sind jedoch ein mehrstufiges Verfahren. Die Zufallslogik setzt hingegen eine einfache Tätigkeit voraus. Im Sinne der Legende könnte das Temperierverfahren also auch ausgelassen worden sein. Da der Fettreif direkt dem Conchieren zugeschrieben wird, könnte es sich aber auch um einen klassischen Fall von Selbsttäuschung gehandelt haben. Bevor der wichtigste Schokoladenpionier der Schweiz durch den Kakao gezogen wird, hätte man sich aber doch zumindest ein wenig mit der Materie auseinandersetzen können. Der Versuch R. Lindt unbedeutender als einen Azubi darzustellen, scheitert am logischen Verständnis. Der Vergleich verkommt dadurch zur rein abwertenden Plattitüde.
Gegendarstellung: An dieser Stelle wird die Entwicklungsphase beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt kannte man aber noch keine Lösung für das Fettreifproblem. Diese Thematik steht im Zusammenhang mit der unkontrollierten Kristallisation des Kakaofetts. Um auf die Fettkristalle einwirken zu können, musste die Masse zunächst in einen zähflüssigen Zustand gebracht werden. Dies gelang erst durch die Verfeinerung und Erhöhung des Fettgehalts während des Conchierens. Indem die Temperatur der zähflüssigen Masse anschliessend reduziert und wieder erhöht wurde, liessen sich die Kristalle stabilisieren. Die ausgehärtete Schokolade war dadurch stabil genug, um sie brechen zu können. Ausserdem erhielt sie auf diese Weise eine glänzende Oberfläche. Das Verfahren wird Temperieren genannt. Dank diesem Temperaturintervall konnte schliesslich auch das Fettreifproblem gelöst werden.
Abweichung: Der Vergleich zwischen einem Lehrling und einem Profi ist das Paradebeispiel aus der «Zufallskategorie». Demnach soll das Fachwissen eines Anfängers besser gewesen sein als das von R. Lindt. Damit wird die Lehrzeit in Lausanne qualitativ infrage gestellt. Im Kontext dieser Entwicklung werden jedoch Äpfel mit Birnen verglichen. Die Kenntnisse des Fettreifes waren nämlich völlig irrelevant. Im Zentrum stand vielmehr die Lösung des Fettreifproblems. Ein Konditorlehrling von anno dazumal konnte diese Kenntnis noch gar nicht haben. Der Vergleich ist somit unlogisch und führt zu einer falschen Einschätzung der Situation. So geht nämlich vergessen, dass auch noch die richtigen Temperaturintervalle für die Berner Schmelzschokolade definiert werden mussten. An dieser Stelle im Buch hätte das Temperierhandwerk unbedingt zu Wort kommen müssen. Möglicherweise wurde dieser wichtige Verfahrensschritt einfach so vergessen. Conchieren und Temperieren sind jedoch ein mehrstufiges Verfahren. Die Zufallslogik setzt hingegen eine einfache Tätigkeit voraus. Im Sinne der Legende könnte das Temperierverfahren also auch ausgelassen worden sein. Da der Fettreif direkt dem Conchieren zugeschrieben wird, könnte es sich aber auch um einen klassischen Fall von Selbsttäuschung gehandelt haben. Bevor der wichtigste Schokoladenpionier der Schweiz durch den Kakao gezogen wird, hätte man sich aber doch zumindest ein wenig mit der Materie auseinandersetzen können. Der Versuch R. Lindt unbedeutender als einen Azubi darzustellen, scheitert am logischen Verständnis. Der Vergleich verkommt dadurch zur rein abwertenden Plattitüde.
Wochenende
Wochenende
«Dass R. Lindt sich in der Jugend als brillanter Student, fleissiger Arbeiter oder furchtloser Abenteurer hervorgetan hätte, ist nicht bekannt. Verbürgt ist lediglich, dass er eine Vorliebe für die Jagd und die schönen Künste hatte (Patriarchen, A. Capus, S. 18)».
Unter der Woche freut sich eine «freizeitorientierte» Person bestimmt aufs nächste Wochenende. Auf diese Weise mutiert die Freizeit- zu einer «Wochenendorientierung». Ein wochenendorientierter Arbeiter wird sich jedoch richtiggehend vom einen zum anderen Wochenende hangeln. Die «Wochenendorientierung» transformiert sich so zur «Faulheit». Der Wochenendteil der Legende assoziiert die Freizeit folglich mit einer gewissen Arbeitsfaulheit. Die Anerkennung einer Leistung sinkt, wenn der Erfolg auch von einer faulen Person erreicht werden kann. Gemäss dem Narrativ eines «unprofessionellen» und «faulen» R. Lindt sollen seine Erfolge nicht wirklich verdient gewesen sein. Im Buch wird ihm mehrfach «Faulheit» unterstellt. Diese Stellen lassen sich in der «Wochenendkategorie» zusammenfassen. Auf diese Weise geben sich weitere Verknüpfungen des «Zufallswochenendes» zu erkennen.
«Dass R. Lindt sich in der Jugend als brillanter Student, fleissiger Arbeiter oder furchtloser Abenteurer hervorgetan hätte, ist nicht bekannt. Verbürgt ist lediglich, dass er eine Vorliebe für die Jagd und die schönen Künste hatte (Patriarchen, A. Capus, S. 18)».
Unter der Woche freut sich eine «freizeitorientierte» Person bestimmt aufs nächste Wochenende. Auf diese Weise mutiert die Freizeit- zu einer «Wochenendorientierung». Ein wochenendorientierter Arbeiter wird sich jedoch richtiggehend vom einen zum anderen Wochenende hangeln. Die «Wochenendorientierung» transformiert sich so zur «Faulheit». Der Wochenendteil der Legende assoziiert die Freizeit folglich mit einer gewissen Arbeitsfaulheit. Die Anerkennung einer Leistung sinkt, wenn der Erfolg auch von einer faulen Person erreicht werden kann. Gemäss dem Narrativ eines «unprofessionellen» und «faulen» R. Lindt sollen seine Erfolge nicht wirklich verdient gewesen sein. Im Buch wird ihm mehrfach «Faulheit» unterstellt. Diese Stellen lassen sich in der «Wochenendkategorie» zusammenfassen. Auf diese Weise entdeckt man weitere Verknüpfungen des «Zufallswochenendes».
Gegendarstellung: Dieser Satz bezieht sich auf die erfolgreiche Zeit nach der Entdeckung der Berner Schmelzschokolade. Bereits den Grossteil seiner Lausanner Ausbildungsjahre verbrachte R. Lindt in der Fabrikhalle seines Onkels. Nach der Lehrzeit wäre er bestimmt nicht den Weg eines Schokoladenfabrikanten weitergegangen, wenn er «edle Salons» bevorzugt hätte. Entgegen der Legendenlogik erforderte aber auch die Experimentierphase seine Anwesenheit in der Mühle, weil sich Entwicklungsarbeiten nicht delegieren lassen.
Abweichung: Dieser Satz hebt die «Freizeitorientierung» besonders gut hervor. Er kann sogar als Paradebeispiel der Wochenendkategorie bezeichnet werden, weil der vermeintliche Arbeitsmuffel direkt angesprochen wird. Die Work-Life-Balance von R. Lindt gerät dadurch definitiv in Schieflage. Wenn ein Selbständigerwerbender die Arbeit meidet, so würde er sich eigentlich ins eigene Fleisch schneiden. Eine Person mit Hang zu «edlen» Dingen, kann als «eitel» wahrgenommen werden. Auch an dieser Stelle im Buch wird diese Eigenschaft mit dem Burgerhintergrund verbunden.
Gegendarstellung: Dieser Satz bezieht sich auf die erfolgreiche Zeit nach der Entdeckung der Berner Schmelzschokolade. Bereits den Grossteil seiner Lausanner Ausbildungsjahre verbrachte R. Lindt in der Fabrikhalle seines Onkels. Nach der Lehrzeit wäre er bestimmt nicht den Weg eines Schokoladenfabrikanten weitergegangen, wenn er «edle Salons» bevorzugt hätte. Entgegen der Legendenlogik erforderte aber auch die Experimentierphase seine Anwesenheit in der Mühle, weil sich Entwicklungsarbeiten nicht delegieren lassen.
Abweichung: Dieser Satz hebt die «Freizeitorientierung» besonders gut hervor. Er kann sogar als Paradebeispiel der Wochenendkategorie bezeichnet werden, weil der vermeintliche Arbeitsmuffel direkt angesprochen wird. Die Work-Life-Balance von R. Lindt gerät dadurch definitiv in Schieflage. Wenn ein Selbständigerwerbender die Arbeit meidet, so würde er sich eigentlich ins eigene Fleisch schneiden. Eine Person mit Hang zu «edlen» Dingen, kann als «eitel» wahrgenommen werden. Auch an dieser Stelle im Buch wird diese Eigenschaft mit dem Burgerhintergrund verbunden.
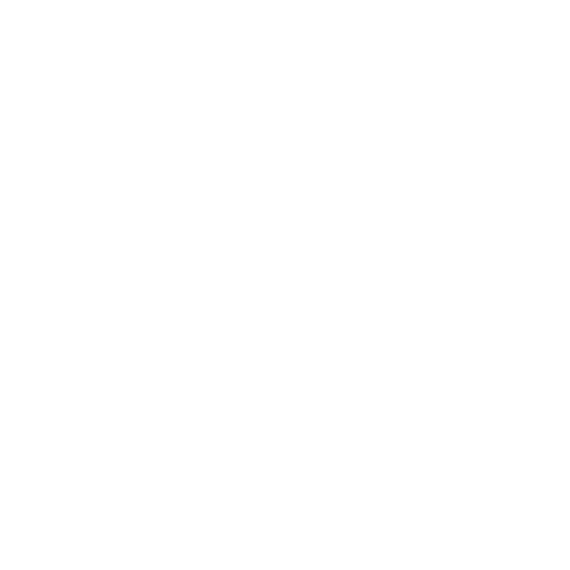
Gegendarstellung: Dieser Satz bezieht sich auf die Beendigung der Partnerschaft mit J. Tobler. Zu Beginn verkaufte R. Lindt seine Schmelzschokolade am Bieler- und Neuenburgersee. Die Schüler und Schülerinnen der internationalen Schulen gehörten dort zu seiner Kundschaft. Dank dieser Verkaufsstrategie verbreitete sich die neuartige Schokolade auch im Ausland. Deutschland entwickelte sich so zu einem wichtigen Absatzmarkt der Rod. Lindt Fils. Erst später kam es zur Zusammenarbeit mit Tobler. Für eine gewisse Zeit vertrieben Toblers Handelsreisende nebst den eigenen Produkten auch die Schmelzschokolade aus der Berner Matte. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Länggassequartier jedoch elektrifiziert. Die Familie Tobler konnte dadurch eine eigene Schokoladenproduktion aufbauen. Somit war sie nicht mehr auf die teure Schokolade von R. Lindt angewiesen. Es hatte sich aber nicht um einen Exklusivvertrag gehandelt. Auch ohne Tobler blieb zumindest das eigen Vertriebsnetzt bestehen.
1899 belief sich der Kaufpreis für die Schokoladenmanufaktur der Rod. Lindt Fils auf 1.5 Mio. In den juristischen Akten wurde dieser Wert später präzisiert:
«Die Lindt-Chocolade besitzt Weltruf. Für den Namen und das Verfahren hat die Klägerin 1.3 Mio. bezahlt (Berufung 1927, Klägerin, S. 4)».
Die 1'300'000.- beziehen sich auf den Mehrwert (Goodwill), welcher für das Fabrikationsverfahren, den Namen, die Kundschaft und die Marke gezahlt wurde. Aus der Differenz zum Kaufpreis lässt sich ein Sachwert von 200'000.- errechnen, welcher für die Schokoladenmühle, die Maschinen und sonstige Einrichtungen bezahlt wurde. Beim Verkauf seines Unternehmens hatte R. Lindt also ein sehr gutes Händchen. Im zitierten Berufungsschreiben attestierte ihm selbst die Gegenseite einen Weltruf.
1899 bezog der Direktor des Berner Standortes ein Jahressalär von 4'000.- (Urteil gegen A. Lindt 1909, Obergericht, S. 4). Gemäss dem statistischen Lohnrechner von 2022 lag das durchschnittliche Jahreseinkommen einer Arbeitsstelle mit ähnlicher Funktion bei rund 154'000.-. Mit diesen Angaben lässt sich ein Faktor von 39 errechnen. Der Mehrwert von 1.3 Mio. würde heute also rund 51 Mio. entsprechen. In der Firmenbiografie von 1995 wird sogar ein Faktor von 50 empfohlen:
«Wer mit einem Verhältnis von 1:50 operiert, liegt in den meisten Lebenslagen wenigstens nicht allzu grob daneben (150 Jahre Freude bereiten, P. Treichler, G. Corradi, S. 56)»
Von 1879 bis 1899 wurde pro Jahr durchschnittlich ein Mehrwert von 65'000.- erarbeitet. In heutigen Zahlen entspricht das einem jährlichen Zuwachs von 2,5 Mio. Ohne Verkaufsfleiss wäre eine solche Wertsteigerung unmöglich gewesen. In der Berner Matte wurde somit nicht nur kaufmännisch, sondern auch technisch eine Leistung erbracht, welche im damaligen Schokoladenmarkt der Schweiz ihresgleichen sucht.
Abweichung: Ohne Fleiss kein Preis steht natürlich nicht im Einklang mit der Legendenlogik. Für das Narrativ musste man R. Lindt deshalb auch noch einen Verkaufsmuffel anhängen. Ein weiteres Mal wird mit der angeblichen «Eitelkeit» eines Burgers kokettiert. Praktisch identisch mit dem Paradesatz handelt es sich um eine Wiederholung. Damit wird wohl versucht, die bereits angedeutete «Faulheit» zu plausibilisieren. Beim Verkauf nach Zürich im Jahr 1899 war die Bewertung seines Unternehmens überdurchschnittlich hoch. Dadurch wird die Diskrepanz zwischen der scheinbar schlechten Arbeitsmoral und der Realität offensichtlich. Selbst die Käufer rechtfertigten später den hohen Kaufpreis mit dem Weltruf der Berner Schmelzschokolade. Damit wurde die Glanzleistung von R. Lindt sogar von der späteren Gegenpartei anerkannt. Wenn der hohe Goodwill tatsächlich ohne Fleiss möglich war, müsste man eigentlich die Höhe des Kaufpreises hinterfragen. Eine kritische Betrachtung der Käuferseite lässt das Narrativ aber erst gar nicht zu. Damit ist ein erster Hinweis auf die fehlende Objektivität gefunden.
Gegendarstellung: Dieser Satz bezieht sich auf die Beendigung der Partnerschaft mit J. Tobler. Zu Beginn verkaufte R. Lindt seine Schmelzschokolade am Bieler- und Neuenburgersee. Die Schüler und Schülerinnen der internationalen Schulen gehörten dort zu seiner Kundschaft. Dank dieser Verkaufsstrategie verbreitete sich die neuartige Schokolade auch im Ausland. Deutschland entwickelte sich so zu einem wichtigen Absatzmarkt der Rod. Lindt Fils. Erst später kam es zur Zusammenarbeit mit Tobler. Für eine gewisse Zeit vertrieben Toblers Handelsreisende nebst den eigenen Produkten auch die Schmelzschokolade aus der Berner Matte. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Länggassequartier jedoch elektrifiziert. Die Familie Tobler konnte dadurch eine eigene Schokoladenproduktion aufbauen. Somit war sie nicht mehr auf die teure Schokolade von R. Lindt angewiesen. Es hatte sich aber nicht um einen Exklusivvertrag gehandelt. Auch ohne Tobler blieb zumindest das eigen Vertriebsnetzt bestehen.
1899 belief sich der Kaufpreis für die Schokoladenmanufaktur der Rod. Lindt Fils auf 1.5 Mio. In den juristischen Akten wurde dieser Wert später präzisiert:
«Die Lindt-Chocolade besitzt Weltruf. Für den Namen und das Verfahren hat die Klägerin 1.3 Mio. bezahlt (Berufung 1927, Klägerin, S. 4)».
Die 1'300'000.- beziehen sich auf den Mehrwert (Goodwill), welcher für das Fabrikationsverfahren, den Namen, die Kundschaft und die Marke gezahlt wurde. Aus der Differenz zum Kaufpreis lässt sich ein Sachwert von 200'000.- errechnen, welcher für die Schokoladenmühle, die Maschinen und sonstige Einrichtungen bezahlt wurde. Beim Verkauf seines Unternehmens hatte R. Lindt also ein sehr gutes Händchen. Im zitierten Berufungsschreiben attestierte ihm selbst die Gegenseite einen Weltruf.
1899 bezog der Direktor des Berner Standortes ein Jahressalär von 4'000.- (Urteil gegen A. Lindt 1909, Obergericht, S. 4). Gemäss dem statistischen Lohnrechner von 2022 lag das Jahreseinkommen einer Arbeitsstelle mit ähnlicher Funktion im Durchsnitt bei rund 154'000.-. Mit diesen Angaben lässt sich ein Faktor von 39 errechnen. Der Mehrwert von 1.3 Mio. würde heute also rund 51 Mio. entsprechen. In der Firmenbiografie von 1995 wird sogar ein Faktor von 50 empfohlen:
«Wer mit einem Verhältnis von 1:50 operiert, liegt in den meisten Lebenslagen wenigstens nicht allzu grob daneben (150 Jahre Freude bereiten, P. Treichler, G. Corradi, S. 56)»
Von 1879 bis 1899 wurde pro Jahr durchschnittlich ein Mehrwert von 65'000.- erarbeitet. In heutigen Zahlen entspricht das einem jährlichen Zuwachs von 2,5 Mio. Ohne Verkaufsfleiss wäre eine solche Wertsteigerung unmöglich gewesen. In der Berner Matte wurde somit nicht nur kaufmännisch, sondern auch technisch eine Leistung erbracht, welche im damaligen Schokoladenmarkt der Schweiz ihresgleichen sucht.
Abweichung: Ohne Fleiss kein Preis steht natürlich nicht im Einklang mit der Legendenlogik. Für das Narrativ musste man R. Lindt deshalb auch noch einen Verkaufsmuffel anhängen. Ein weiteres Mal wird mit der angeblichen «Eitelkeit» eines Burgers kokettiert. Praktisch identisch mit dem Paradesatz handelt es sich um eine Wiederholung. Damit wird wohl versucht, die bereits angedeutete «Faulheit» zu plausibilisieren. Beim Verkauf nach Zürich im Jahr 1899 war die Bewertung seines Unternehmens überdurchschnittlich hoch. Dadurch wird die Diskrepanz zwischen der scheinbar schlechten Arbeitsmoral und der Realität offensichtlich. Selbst die Käufer rechtfertigten später den hohen Kaufpreis mit dem Weltruf der Berner Schmelzschokolade. Damit wurde die Glanzleistung von R. Lindt sogar von der späteren Gegenpartei anerkannt. Wenn der hohe Goodwill tatsächlich ohne Fleiss möglich war, müsste man eigentlich die Höhe des Kaufpreises hinterfragen. Eine kritische Betrachtung der Käuferseite lässt das Narrativ aber erst gar nicht zu. Damit wäre wohl ein erster Hinweis auf die fehlende Objektivität gefunden.
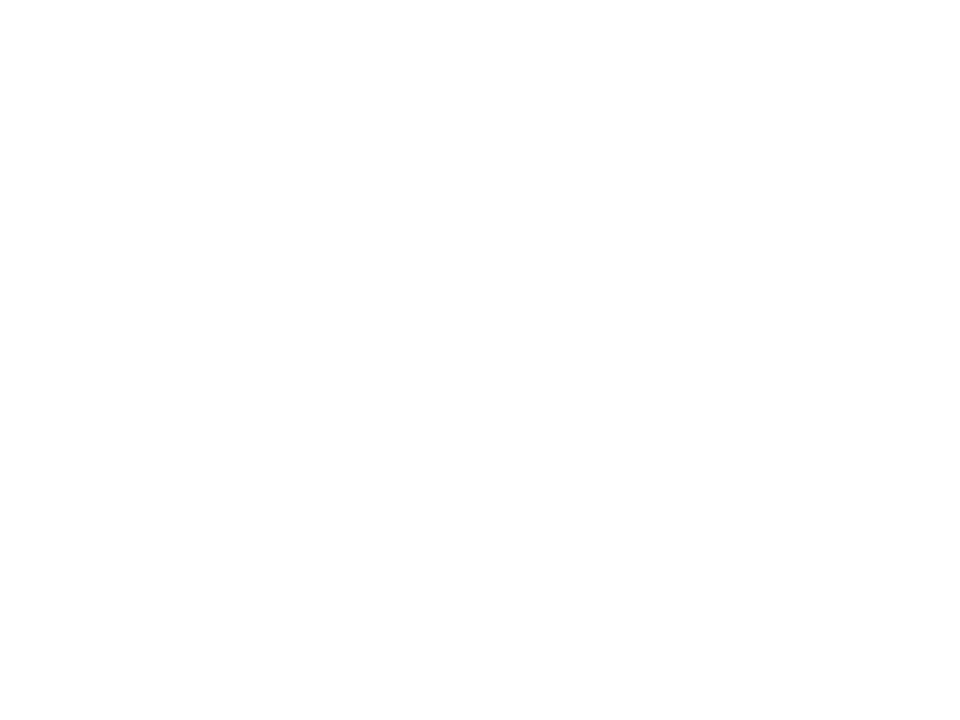
Gegendarstellung: Hier wird die Ausgangslage beim Verkauf der Rod. Lindt Fils nach Zürich beschrieben. 1836 konnte David S. eine Zürcher Konditorei übernehmen. 1845 begann sein Sohn Rudolf S. mit der Schokoladenproduktion (2. Führungsgeneration). 1892 wurde der Betrieb in Zürich auf zwei Söhne aufgeteilt. David Robert S. führte die Konditorei weiter (heutige Confiserie Sprüngli). Der Schokoladenbereich ging an Johann Rudolf S. und die Gründung der Chocolat Sprüngli erfolgte im Jahr 1898 (Tradition mit Zukunft, C. Hämmig, S11). Bei der Übernahme im Jahre 1899 war die Chocolat Sprüngli AG folglich in 3. Generation geführt.
Bei der übernommenen Rod. Lindt Fils war jedoch noch der Gründer an Bord. Eine Zunftfamilie ist das Zürcher Pendant zur Burgerfamilie. Die Familie Lindt gehört seit 1805 der Gesellschaft zu Mittellöwen an. Die Zunftzugehörigkeit der Familie Sprüngli geht auf das Jahr 1839 zurück (Tradition mit Zukunft, C. Hämmig, S. 127). Der Vater von R. Lindt war Apotheker und engagierte sich politisch sowohl als Gemeinderat als auch im Grossen Rat (Kantonsrat). Mit seinem Apothekerwissen steuerte er einen wichtigen Beitrag zur heutigen Schokolade bei. R. Lindt Senior war ausserdem Mitbegründer des Schweizer Alpenclubs (SAC).
Abweichung: Auch diese Beschreibungen bedienen die «Freizeit» und «Eitelkeit» des Narrativs. Ein gegensätzlicher Vergleich ist mathematisch eine Ungleichung. Auf diese Weise sind die positiven Eigenschaften der Zürcher Familie weitere Abwertungen von R. Lindt. Hüben wie drüben handelte es sich aber um Zunftfamilien. Daher kann «aristokratisch» weggekürzt werden. Ausserdem wird die Gründergeneration mit der dritten Generation verglichen. Normalerweise wird der Pioniergeist einem Gründer zugeschrieben. Die nachfolgenden Generationen sind, wenn überhaupt, eher verwaltend, verwöhnt, träge usw. Der «dünkelhafte Schöngeist» ist daher eher eine realitätsfremde Abwertung, welche somit auch gestrichen werden kann. Angenommen, der Kaufpreis von 1.5 Mio. soll tatsächlich zu hoch gewesen sein, dann müssten eigentlich die kaufmännischen Fähigkeiten der Zürcher Seite infrage gestellt werden. Das «Arbeitsethos von Zwingli» würde dadurch aber auf verlorenem Posten stehen. Werden nun auch noch die Verdienste von R. Lindt Senior aufgerechnet, so hat sich der Vergleich in Luft aufgelöst. Nach Adam Riese ist die Ungleichung komplett weggekürzt. Der Informationsgehalt dieser Textpassage ist folglich gleich Null. Dank der Gegenüberstellung mit den nackten Fakten kommt an dieser Stelle aber erstmals deutlich zum Vorschein, auf welche Seite der Text zugeschnitten wurde. Damit ist ein weiteres Indiz der fehlenden Objektivität gefunden.
Gegendarstellung: Hier wird die Ausgangslage beim Verkauf der Rod. Lindt Fils nach Zürich beschrieben. 1836 konnte David S. eine Zürcher Konditorei übernehmen. 1845 begann sein Sohn Rudolf S. mit der Schokoladenproduktion (2. Führungsgeneration). 1892 wurde der Betrieb in Zürich auf zwei Söhne aufgeteilt. David Robert S. führte die Konditorei weiter (heutige Confiserie Sprüngli). Der Schokoladenbereich ging an Johann Rudolf S. und die Gründung der Chocolat Sprüngli erfolgte im Jahr 1898 (Tradition mit Zukunft, C. Hämmig, S11). Bei der Übernahme im Jahre 1899 war die Chocolat Sprüngli AG folglich in 3. Generation geführt.
Bei der übernommenen Rod. Lindt Fils war jedoch noch der Gründer an Bord. Eine Zunftfamilie ist das Zürcher Pendant zur Burgerfamilie. Die Familie Lindt gehört seit 1805 der Gesellschaft zu Mittellöwen an. Die Zunftzugehörigkeit der Familie Sprüngli geht auf das Jahr 1839 zurück (Tradition mit Zukunft, C. Hämmig, S. 127). Der Vater von R. Lindt war Apotheker und engagierte sich politisch sowohl als Gemeinderat als auch im Grossen Rat (Kantonsrat). Mit seinem Apothekerwissen steuerte er einen wichtigen Beitrag zur heutigen Schokolade bei. R. Lindt Senior war ausserdem Mitbegründer des Schweizer Alpenclubs (SAC).
Abweichung: Auch diese Beschreibungen bedienen die «Freizeit» und «Eitelkeit» des Narrativs. Ein gegensätzlicher Vergleich ist mathematisch eine Ungleichung. Auf diese Weise sind die positiven Eigenschaften der Zürcher Familie weitere Abwertungen von R. Lindt. Hüben wie drüben handelte es sich aber um Zunftfamilien. Daher kann «aristokratisch» weggekürzt werden. Ausserdem wird die Gründergeneration mit der dritten Generation verglichen. Normalerweise wird der Pioniergeist einem Gründer zugeschrieben. Die nachfolgenden Generationen sind, wenn überhaupt, eher verwaltend, verwöhnt, träge usw. Der «dünkelhafte Schöngeist» ist daher eher eine realitätsfremde Abwertung, welche somit auch gestrichen werden kann. Angenommen, der Kaufpreis von 1.5 Mio. soll tatsächlich zu hoch gewesen sein, dann müssten eigentlich die kaufmännischen Fähigkeiten der Zürcher Seite infrage gestellt werden. Das «Arbeitsethos von Zwingli» würde dadurch aber auf verlorenem Posten stehen. Werden nun auch noch die Verdienste von R. Lindt Senior aufgerechnet, so hat sich der Vergleich in Luft aufgelöst. Nach Adam Riese ist die Ungleichung komplett weggekürzt. Der Informationsgehalt dieser Textpassage ist folglich gleich Null. Dank der Gegenüberstellung mit den nackten Fakten kommt an dieser Stelle aber erstmals deutlich zum Vorschein, auf welche Seite der Text zugeschnitten wurde. Damit ist ein weiteres Indiz der fehlenden Objektivität gefunden.
Fazit
Fazit
Faul, eitel, dünkelhaft, exzentrisch und launisch sind ungünstige Charaktereigenschaften für eine Partnerschaft. Im Kapitel über den Streit wird sich herausstellen, dass damit die Berner Seite zum Sündenbock gemacht werden soll. Der «Wochenendteil» ist somit das Bindeglied zwischen der «Legende» und dem «Streit». Dadurch ist das «Zufallswochenende» mit dem gesamten Text verknüpft.
Ein fleissiger Profi hat sich den Erfolg erarbeitet. Das Narrativ eines «faulen Anfängers» erweckt jedoch den Eindruck, dass R. Lindt mehr Glück als Verstand hatte. Zurückkommend auf die Kommunikationstheorie ist im «Zufallswochenende» die Summe dieser abwertenden Verknüpfungen enthalten. Im Umkehrschluss können in nur einer Botschaft gleich mehrere Abwertungen verbreitet werden. Die Legende ähnelt einem Überraschungsei. Anstelle von «Spass», «Spiel» und «Spannung» enthält sie jedoch verschiedene negative Assoziationen.
In «Patriarchen» wurde eine blumige Sprache verwendet. Statt dem Wolf einen Schafspelz zu verpassen, ist das Überraschungsei also mit einer süssen Hülle ummantelt (dragiert). Die Legende wirkt dadurch harmlos. Daher wird sie bedenkenlos verbreitet. Damit hat sie sich als äusserst verfängliches Kommunikationsinstrument bewährt. Die Geschichte hatte aber auch eine dunkle Schokoladenseite. Nur unter Beleuchtung dieser Hintergründe gibt sich die zartbittere Füllung des Überraschungseis zu erkennen. Im nächsten Kapitel ist es entsprechend finster. Auch wenn der «Spass» diesem «Spiel» gleich entgleiten wird, so bleibt doch zumindest die «Spannung» bis zum Schluss bestehen.
Faul, eitel, dünkelhaft, exzentrisch und launisch sind ungünstige Charaktereigenschaften für eine Partnerschaft. Im Kapitel über den Streit wird sich herausstellen, dass damit die Berner Seite zum Sündenbock gemacht werden soll. Der «Wochenendteil» ist somit das Bindeglied zwischen der «Legende» und dem «Streit». Das «Zufallswochenende» ist so mit dem gesamten Text verknüpft.
Ein fleissiger Profi hat sich den Erfolg erarbeitet. Das Narrativ eines «faulen Anfängers» erweckt jedoch den Eindruck, dass R. Lindt mehr Glück als Verstand hatte. Zurückkommend auf die Kommunikationstheorie ist im «Zufallswochenende» die Summe dieser abwertenden Verknüpfungen enthalten. Im Umkehrschluss können in nur einer Botschaft gleich mehrere Abwertungen verbreitet werden. Die Legende ähnelt einem Überraschungsei. Anstelle von «Spass», «Spiel» und «Spannung» enthält sie jedoch verschiedene negative Assoziationen.
In «Patriarchen» wurde eine blumige Sprache verwendet. Statt dem Wolf einen Schafspelz zu verpassen, ist das Überraschungsei also mit einer süssen Hülle ummantelt (dragiert). Die Legende wirkt dadurch harmlos. Daher wird sie bedenkenlos verbreitet. Damit hat sie sich als äusserst verfängliches Kommunikationsinstrument bewährt. Die Geschichte hatte aber auch eine dunkle Schokoladenseite. Nur unter Beleuchtung dieser Hintergründe gibt sich die zartbittere Füllung des Überraschungseis zu erkennen. Im nächsten Kapitel ist es entsprechend finster. Auch wenn der «Spass» diesem «Spiel» gleich entgleiten wird, so bleibt doch zumindest die «Spannung» bis zum Schluss bestehen.